 |
Küchengeschichte:
Frau Gertrud Schleipen, Jülich,
Deutschland
Ich bin 1935 in Inden geboren,
die Jüngste von vieren und das einzige Mädchen.
Mein Vater hatte eine Bäckerei.
Der Krieg hat unser Familienleben schon zeitig sehr
geprägt. 1943 mussten wir die Bäckerei schließen, weil
mein Vater Soldat wurde. Er kam 1945 aus Gefangenschaft
zurück. Alle drei Brüder waren im Krieg. Der älteste
Bruder, 17 Jahre alt, wurde schon 1942 eingezogen und
kam erst vier Jahre nach Kriegsende aus russischer Gefangenschaft
zurück. Mein zweiter Bruder wurde achtzehnjährig 1944
nach Frankreich geschickt und gilt als vermisst. Der
jüngste, 17 Jahre alt, musste Schützengräben ausheben
und kam dann zu den Gebirgsjägern in Italien. In diesen
Jahren war der wichtigste Mensch in unserer Umgebung
der Postbote.
Fast zwei Jahre lang war ich alleine
mit meiner Mutter, die gehbehindert war. Sie hatte die
besondere Begabung, aus wenig etwas machen zu können,
das hat uns sehr geholfen, über die Runden zu kommen.
„Unsere“ Soldaten schickten uns Feldpostpäckchen, darin
waren harte Kekse, die ich besonders liebte, wenn sie
in Milch eingeweicht wurden mit bisschen Zucker dran.
Vom Bauern haben wir Milch geholt,
den Rahm abgeschöpft und ihn so lange geschüttelt, bis
er zu Butter wurde. Aufs Brot geschmiert und Rübenkraut
drauf: Das Abendessen war fertig. Das esse ich heute
noch gerne. Butter war auch ein zugkräftiges Zahlungsmittel,
wenn wir mal einen Handwerker brauchten. Natürlich wurde
viel gemaggelt (getauscht), ohne die Tauschgeschäfte
wären damals viele Familien nicht über die Runden gekommen.
In der Nachkriegszeit war alles
sehr knapp, besonders auch das Essen. Mittags gab es
meistens Suppe. Sie bestand aus dem Schwellwasser verschiedener
Gemüse aus dem Garten, manchmal mit einem Maggiwürfel.
Mit Suppe ist der halbe Hunger weg. Als Hauptgericht
gab es Kartoffeln und Gemüse, selten Fleisch, und danach
Nachtisch aus Eingemachtem, auch aus dem Garten. Sehr
oft gab es auch Eintopf oder Gemüse aus Brennnesseln,
Löwenzahn oder Sauerampfer, die Mutter und ich gesammelt
hatten. Heute ist das gar nicht mehr möglich, weil alles
zu dreckig ist.
Um einkaufen zu können musste
man Lebensmittelkarten haben. Sie waren eingeteilt und
entsprechend markiert: Nr. 11 für Erwachsene, Nr. 13
für Jugendliche. Es gab für Kinder, Kleinkinder und
Säuglinge, werdende und stillende Mütter, Schwerarbeiter,
Schwerstarbeiter, (meist im Bergbau), usw. gesonderte
Karten. Die Nummern, die keine Bezeichnung trugen, wurden
in der Tageszeitung für Sonderzuteilungen aufgerufen.
Rauchermarken waren, wenn man sie missen konnte, DIE
TAUSCHWÄHRUNG schlechthin. Dafür konnte man fast alles
haben.
Freitags haben wir, wenn wir die
Lebensmittelkarten dafür hatten, ein Döschen Fisch gegessen,
mit Kartoffeln, die überhaupt bei jeder Mahlzeit dabei
waren. Kartoffeln mit fast nichts dazu, morgens, mittags,
abends. Manchmal, wenn die Lebensmittelkarten es erlaubten,
gab es Quark und Kräuter dazu. Das schmeckte! Wenn es
mal etwas Außergewöhnliches zu kaufen gab, also z. B.
Salzheringe, musste ich „einkaufen“ gehen. Das hieß,
den blauen Familienpass mitnehmen, nach dem die Menge
Salzheringe anteilig der eingetragenen Personen berechnet
wurde, lange und geduldig in der Schlange stehen und
hoffen, dass noch etwas da war, wenn ich an der Reihe
war. Das war durchaus nicht immer der Fall.
In der Bäckerei wurde natürlich
nichts verkauft, ohne dass Lebensmittelkarten abgegeben
wurden, denn die Bäckerei musste ja Rechenschaft abgeben
über die Geschäfte, um die für das Backen notwendigen
Zutaten zugeteilt zu bekommen wie Mehl, Zucker, Fett
usw.
Abends nach den Hausaufgaben habe
ich sie mit Kartoffelmehlkleister aufgeklebt, das war
meine Aufgabe.
Süßes gab es selten. Manchmal
machte Mutter sonntags Klümpchen. Sie hat ein kleines
Stück Butter gebräunt, karamellisiert, einen Teller
mit Zucker bedeckt, mit dem Teelöffel kleine Kuhlen
eingedrückt und die Bonbonmasse reingelöffelt. Der Zucker
um die Kuhlen herum wurde wieder eingesammelt, aber
zehn Klümpchen ungefähr konnten wir uns teilen.
Nachtisch gab es oft, die Regale
im Keller standen voll mit Eingemachtem. Wenn es Kirschen
zum Nachtisch gab, wurden nach dem Essen die Kirschkerne
gezählt. Wer weniger Kerne liegen hatte bekam Kirschen
nach. Heimlich habe ich immer ein paar verschluckt und
mir damit einen Nachschlag gesichert.
Trevvel (Rührei mit Speck) haben
wir in der schweren Zeit nur aus Ei und Mehl gemacht,
später, als die Zeiten besser wurden, wurde der Trevvel
üppiger, da benutzten wir mehr Zutaten. Mit Vielem hält
man Haus, mit wenig kommt man aus. Übrigens gebrauchte
man für das Quirlen des Trevvel Schneebesen. Sie waren
aus Aluminium und verfärbten die Speisen silbergrau.
Praktisch, wie mein Vater war, band er Reisigbesen.
Dazu wurden Birkenzweige gekocht, damit die braune Rinde
abfiel, sie wurden passend geschnitten und gebunden
und funktionierten vorzüglich.
Ab und zu wurde auch geschlachtet.
Weil damals kaum jemand einen Kühlschrank hatte, musste
man das Frischfleisch vom Schlachtfest zuerst in Buttermilch,
dann eine Woche lang in Marinade einlegen, so wurde
es länger haltbar. Oder Bratfleisch wurde angebraten,
in passende Stücke geschnitten und zusammen mit Bratfett
und -saft in Weckgläser gefüllt und eingekocht. So machte
man das auch mit Blut- und Leberwurst und mit Schweinemett.
Das war viel Arbeit, aber es machte das Fleisch haltbar
und die Weckgläser füllten die Kellerregale. Natürlich
standen im Keller auch Steintöpfe mit Sauerkraut und
Bohnen. Wenn das kostbare Sauerkraut knapper wurde,
haben wir es zusammen mit weißen Bohnen gekocht: Bohnengemüse
„mit Lametta“ und Kartoffelpuffer gab es dann zu essen.
Weil die Zeiten so schwer waren,
gab es in der Schule Schulspeisung für uns. Dafür habe
ich einen emaillierten Halbliterbecher mitgenommen,
den habe ich heute noch. Meistens gab es für uns sämige
Suppen oder, was alle Kinder liebten, Kakao. Es gab
auch Pakete mit Essen und Kleidung, sogenannte Carepakete,
die Amerikaner an Deutsche schickten, aber davon haben
wir nur gehört, wir haben keins gesehen und kannten
auch niemanden, der eins bekommen hätte.
Im Großen und Ganzen esse ich noch
immer vieles, was wir damals zu Hause gekocht haben,
ganz anders als meine Kinder, die viel anspruchsvoller
sind. Vieles haben wir damals ja nicht gekannt und darum
auch nicht vermisst.
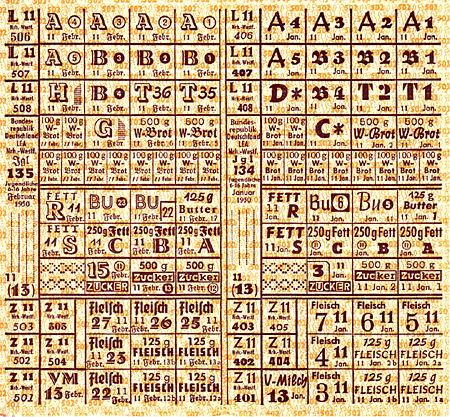
Lebensmittelkarte von 1950, 134. Zuteilungsperiode
 alle
Küchengeschichten alle
Küchengeschichten
|
 |
